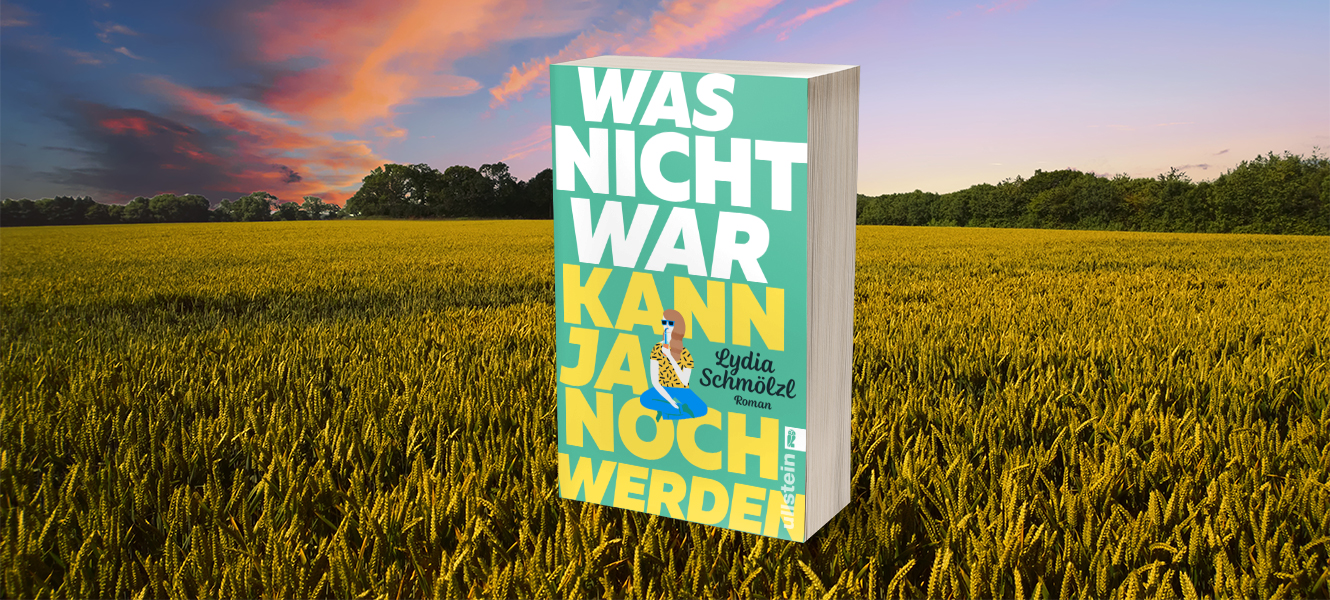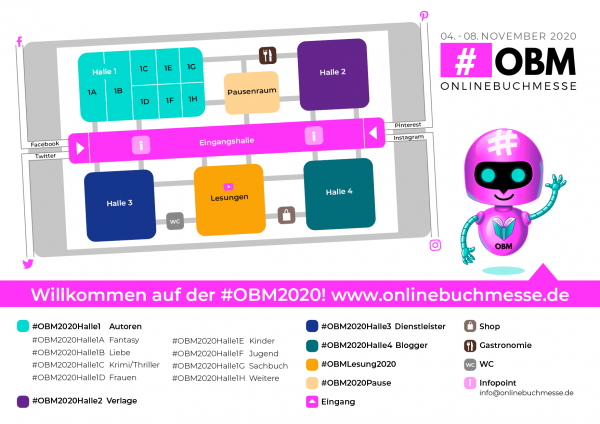1. Selbstagierende Körperteile
Hier haben wir direkt einen der beliebtesten und irgendwie auch lustigsten Schreibfehler, die mir immer wieder begegnen. Da sind die Augen, die über Wände und Türen hüpfen; Hände, die suchend umherwandern und Stimmen, die gottgleich aus dem Nichts erschallen. An manchen Stellen kann solch eine Formulierung natürlich ausnahmsweise einmal sinnvoll sein. Insbesondere die körperlose Stimme kommt häufig zum Einsatz, wenn Figuren in der Geschichte im Koma liegen oder träumen und das ist auch in Ordnung – aber dabei sollte es dann auch bleiben. Augen können nicht hüpfen und Füße können nicht tanzen – zumindest nicht alleine. Meist hängt ja noch ein Körper dran. Hier ein Beispiel:
Ben trat vorsichtig hinter sie. Er strich Anna das Haar aus dem Nacken. Langsam fielen seine Hände auf ihre Schultern.
Welches Bild hast du vor Augen? Wenn du genau liest, klingt es doch, als bräuchte Ben dringend ärztlichen Beistand. Seine Hände sind ihm von den Armen gefallen! Ganz anders so:
Ben trat vorsichtig hinter sie. Mit einer sanften Bewegung strich er Anna das Haar aus dem Nacken und ließ seine Hände behutsam auf ihren Schultern verweilen.
Jetzt merkt der Leser beruhigt: Ben ist vollständig. Der Arzt kann Zuhause bleiben.
2. Inflationärer Einsatz von Sprecherverben
Sprecherverben sind wichtig und unabkömmlich in jedem prosaischen Text. Es sind die kleinen Wörtchen wie „sagte“ oder „fragte“, die eine wörtliche Rede ein- oder ausleiten. Hin und wieder kommt es jedoch vor, dass ein Text geradezu mit ihnen überladen ist. Und nicht nur mit den, ich nenne sie mal, „konservativen“ Formen. Da kommen dann so exotische Sprecherverben wie „wissen“, „grunzen“, „maulen“ zum Einsatz. An einzelnen passenden Stellen eingebaut, können diese Sprecherverben dazu beitragen, einen Text lebendig wirken zu lassen. Werden sie jedoch auf den Text gegossen wie Soße auf den Sonntagsbraten, wirkt es schnell befremdlich. Ein Beispiel:
„Lass uns doch später ins Kino gehen“, schlägt Jan vor
„Heute läuft aber nichts Gutes“, weiß Lisa.
„Nur weil du wieder irgendeine Weiber-Klamotte sehen willst“, protestiert Jan.
Lisa meint eingeschnappt: „Du musst ja nicht mit mir gehen, wenn du nicht willst.“
Der Leser weiß nach einem oder zwei Sprecherverben am Anfang des Dialogs, wer spricht und meistens auch wie (nervös, wütend, ängstlich). Du brauchst nicht nach jedem Satz eine Erklärung abzugeben. Das behindert eher den Lesefluss. Versuch stattdessen lieber, die Situation oder Gedanken deiner Figuren zu beschreiben und so deutlich zu machen, wie sie sich fühlen und dementsprechend auch reden:
„Lass uns doch später ins Kino gehen“, schlägt Jan vor.
Lisa zögert kurz. Ihr ist schon klar, dass diese einfache Frage wieder in einer Diskussion enden wird. „Heute läuft aber nichts Gutes.“
„Nur weil du wieder irgendeine Weiber-Klamotte sehen willst.“ Jan presst die Lippen zu einem dünnen Schlitz zusammen und verdreht die Augen.
„Du musst ja nicht mit mir gehen, wenn du nicht willst.“
Nur ein Sprecherverb, und trotzdem wird deutlich, wer wann spricht und auch in welcher Situation sich Lisa und Jan befinden.
3. Bleib kohärent
Obwohl in Deutschland schon recht viel durch ein striktes Regelwerk festgelegt ist; manchmal habt ihr ein paar Freiheiten, was die Gestaltung eures Textes angeht. Das beginnt natürlich bei der Erzählperspektive. Willst du einen auktorialen, allwissenden Erzähler oder berichtest du lieber aus der Perspektive des Haupt- oder auch Nebencharakters? Es gibt keine Variante, die per se besser ist, sondern kommt darauf an, worauf du deinen Fokus legen möchtest. Willst du das Innenleben des Protagonisten besonders betonen oder vielleicht eine verschachtelte Episoden-Geschichte erzählen?
Als nächstes musst du dich für eine Zeitform entscheiden. Üblich ist hier das Präteritum, aber es spricht natürlich auch nichts dagegen im Präsens zu schreiben.
Und dann sind da noch so Kleinigkeiten wie die Entscheidung zwischen Auslassungspunkten und Gedankenstrichen. Beispielsweise, wenn einer Figur ins Wort gefallen wird oder sie gedanklich abschweift …
Wirklich wichtig ist nur eins: Entscheide dich am Anfang für eine Form und bleib dann dabei! Es gibt nichts Verwirrendes als plötzliche Zeitformsprünge oder einen Protagonisten, der aus der Ich-Perspektive berichtet und plötzlich, wie durch göttliche Eingebung, weiß, was am anderen Ende der Stadt vor sich geht, ohne dass er dabei ist.